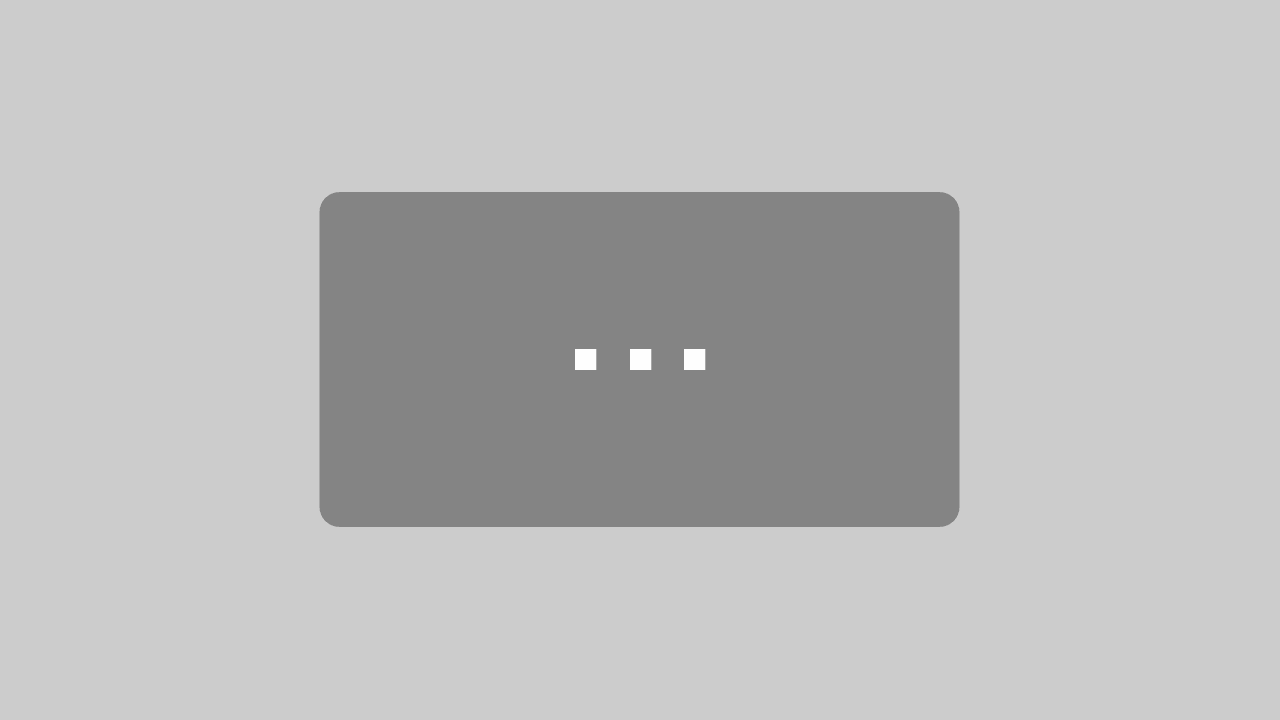Demokratie ist kein Erbgut, das sich automatisch von einer auf die nächste Generation überträgt. Für Demokratie muss man einstehen und sie jeden Tag aufs Neue erarbeiten und festigen. Das gilt erst recht für eine Gesellschaft, die sich im Wandel befindet. Auf der einen Seite treten neben alte ideologische Konflikte und Auseinandersetzungen neue, kulturalisiert bedingte Polarisationen. Hyperindividualistische, kosmopolitische Lebensentwürfe stehen dabei immer häufiger kulturessentialistischen, kommunitären und auf regionalen Zusammenhalt zielende Lebensentwürfen gegenüber. Zum anderen sind die Gesellschaften in entwickelten Demokratien vielfältiger und heterogener geworden. Demokratische Gesellschaften verstehen sich mehrheitlich als offene Gesellschaften, die unterschiedlichste Lebensstile, aber auch Zuwanderung u. a. von geflüchteten Menschen erlauben. Diese Offenheit und Pluralität ist jedoch umstritten und Gegenstand politischer Auseinandersetzungen.
Wir unterscheiden heute grob drei Dimensionen von Demokratie.
Unter der substantiellen Dimension verstehen wir die nicht verhandelbaren Grundprinzipien der Demokratie wie den Schutz von Minderheiten, die Begrenzung der Macht, die Gewaltenteilung, die Rechtstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und nicht zuletzt das Gleichheitsprinzip.
Unter der formalen Dimension der Demokratie verstehen wir dagegen die Verfahren und Bedingungen, wie man zu verbindlichen Regeln kommt, die man aber auch in Frage stellen und verändern kann.
Die prozesshafte Dimension hingegen betont, dass die Demokratie mit ihrer historischen Herstellung nicht gottgegeben und unhinterfragbar ist. Vielmehr haben wir es mit ständig neuen Aushandlungsprozessen zu tun, die festlegen, was gilt.
Zum Beispiel gibt es Einschränkungen, wer an den Wahlen teilnehmen darf und wer nicht. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass Frauen lange an den Wahlen nicht teilnehmen durften. Dafür waren lange Kämpfe und Auseinandersetzungen nötig. Aber auch heute gibt es Einschränkungen. Menschen dürfen erst mit dem 18. Geburtstag an den Bundestags- und Europawahlen teilnehmen. Bei Kommunal- und Landtagswahlen ist dieser Grundsatz schon aufgeweicht. Hier kann man immer häufiger schon mit dem 16. Geburtstag teilnehmen. Die Altersgrenze ist schon seit langem umstritten. Ausgeschlossen von den Wahlen sind aber auch Zugewanderte, die nicht oder noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Damit wird das Gleichheitsprinzip in Demokratien mit mehr oder weniger nachvollziehbaren Argumenten eingeschränkt.
In der Demokratie müssen oft widerstreitende Fragen abgewogen und ausgehandelt werden. Bei der Frage, wie man z. B. die Demokratie vor extremistischen Bestrebungen schützt, müssen Sicherheitsinteressen gegen die legitimen Freiheitsrechte abgewogen werden. Lässt man antidemokratischen Kräften zur Wahrung von Freiheitsrechten zu viel Spielraum, gefährdet man die Demokratie ebenso, als wenn Sicherheitsaspekte dazu führen können, dass individuelle Freiheiten über Gebühr eingeschränkt werden. Auch die Frage, wie den Beteiligungsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung zu tragen ist, darf als kontrovers gelten. Die empirische Beteiligungsforschung weist nämlich darauf hin, dass sich bildungserfolgreiche und privilegierte Menschen viel häufiger an Wahlen und Bürgerentscheiden oder Entscheidungsverfahren beteiligen als bildungs- und sozial benachteiligte Menschen. Demokratien müssen sich deshalb darum kümmern, wie sie mit gesellschaftlicher Ungleichheit umgehen und wie viel Ungleichheit sie aushalten können und wollen.
„Demokratie ist die einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss – nicht ein für allemal, so als könnte man sich einen gesicherten Regelbestand anlegen, der fürs ganze Leben ausreicht, sondern stets aufs Neue, in tagtäglicher Anstrengung und bis ins hohe Alter hinein.“, so der Sozialphilosoph Oskar Negt1 .
Demokratie, so die mehrheitliche Überzeugung braucht politische Bildung. Damit ist aber nicht eine erzieherische Disziplin gemeint, die auf die Übernahme erwünschter affirmativer Werthaltungen abzielt. Einer staatsbürgerlichen Bildung, die es auf die Akzeptanz und Idealisierung bestehender Herrschaftsverhältnisse absieht, wird deshalb eine politische Bildung gegenübergestellt, der es auf die mündigen, emanzipierten und kritischen Bürgerinnen und Bürger ankommt. Diese verstehen sich nicht länger als Untertanen, sondern gestalten Politik aktiv mit. Sie sind Teil des Souveräns und nehmen, auch mit Hilfe politischer Bildung, das Heft des Handelns in die eigene Hand.
Eine so verstandene politische Bildung zielt auf einen ambiguitiven, also ergebnisoffenen Diskurs und bettet sich in Formen lebenslangen Lernens ein. Politische Bildung findet also nicht nur als „formale Bildung“ im Sozialraum Schule statt, sondern begegnet, wie der 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung2 herausarbeitet, in den verschiedenen sozialen Räumen, in denen sich Menschen in unterschiedlichen Konstellationen mehr oder weniger aufhalten und die sie mitgestalten und beeinflussen. In diesem Sinne gehören „nonformale Bildungsangebote“ institutioneller Träger außerhalb der Schule ebenso wie „informelle Selbstlernformen“ in das Gesamtangebot politischer Bildung.
In Abgrenzung zu Vorstellungen einer Demokratieerziehung haben sich seit 1976 Vertreter*innen der Politikdidaktik auf drei Prinzipien der Profession verständigt, die im Beutelsbacher Konsens3 zusammengefasst sind.
Das Überwältigungsverbot verbietet es dabei den Pädagog*innen nicht nur zur gewünschten politischen Meinung zu indoktrinieren. Selbst sublime Formen der Lenkung und Steuerung, die zu politischen Positionen überreden sollen, werden abgelehnt. Lernenden soll ein eigenes Urteil ermöglicht werden.
Das Kontroversitätsgebot legt Wert darauf, dass alle Sachverhalte in der Gesellschaft, die kontrovers diskutiert werden, auch in den Formaten der politischen Bildung kontrovers zu verhandeln sind. Den Lehrkräften kommt eine Korrekturfunktion zu, wenn die Lerngruppen in diesen Kontroversen vorab festgelegt sind.
Das Befähigungsgebot zielt schließlich darauf ab, dass die Lernenden ihre Interessen analysieren können, um die politische Situation im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen. Dieses dritte Prinzip baut, wenn man so will, die Brücke in die praktische Politik und fordert Beteiligung an den politischen Verfahren und Prozessen ein.
In letzter Zeit wurde darüber hinaus eine Diskussion geführt, inwiefern politische Bildung neutral sein solle. Die Antwort fast der gesamten Profession, zuletzt der unabhängigen Expertenkommission des 16. Kinder- und Jugendberichts, der sich explizit mit politischer Bildung befasste, fällt einmütig aus: Politische Bildung ist nicht neutral. Sie definiert sich auf der Basis ihres Verständnisses der Grundrechte und ihrer Menschenrechtsorientierung normativ. Darum können sich z. B. extremistische, rassistische und homophobe Positionen mit Bezug auf eine vermeintliche Neutralität nicht auf den Beutelsbacher Konsens berufen.
Eines der zentralen Themen der letzten Jahre sind die weltweiten Fluchtbewegungen, die auch Deutschland herausgefordert haben. Für die politische Bildung wie auch für die Filmbildung hat sich hier eine große Tür geöffnet. Für eine gelingende Suche nach einem Platz in der Gesellschaft müssen die Geschichten der Flucht erzählt und diskutiert werden. In eigenen, selbst hergestellten Filmen ebenso wie in der Diskussion über professionelle, oft sehr berührende und emotionale Filme kann gegenseitiges Verständnis wachsen. Auch in der eigenen deutschen Geschichte werden Fluchterfahrungen wieder reaktiviert und nicht zuletzt filmisch verarbeitet. Das Exil vieler Deutscher in der NS-Zeit und die damit verbundenen Entbehrungen und Herausforderungen wurden häufig verdrängt und vergessen. An dem Umgang mit Geflüchteten heute wird der eigene menschenrechtliche Anspruch gemessen und auf Glaubwürdigkeit hin überprüft werden.
Politische Bildung hat sich, ausgehend von ihrem normativen Grundverständnis, verstärkt interdisziplinär aufgestellt. An den Schnittstellen zu sozialer Arbeit, der Bildung für eine nachhaltige Gesellschaft, der kulturellen Bildung, der Medienbildung und in Verzahnung mit sozialräumlichen Strategien in Transformationsprozessen sucht sie nach neuen Wirkungsfeldern, um ihre Ansprüche der Stärkung des demokratischen Gedankens zu verfolgen.
Dabei geht es nicht um eine Vereinnahmung der jeweiligen Handlungsfelder. Vielmehr sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten den Blick für eine gelingende Zusammenarbeit weiten. Die jahrzehntelangen Kooperationen der politischen Bildung (und hier insbesondere der Bundeszentrale für politische Bildung) auf dem Feld der Film- und Medienbildung haben sich zu beiderseitigem Nutzen entwickelt. Dabei öffnet sich auch der Blick auf Aspekte, die in der eigenen Disziplin eher ein randständiges Dasein gefristet haben. So galten Emotion und Emphase in der auf Argumentation und Rationalität abonnierten politischen Bildung lange als abwegig, obwohl kein Bildungsprozess ohne Emotion und Emphase auskommt. Immerhin hat das Thema es schon zum Konferenzgegenstand des zentralen Bundeskongresses der politischen Bildung geschafft. Umgekehrt profitiert die Film- und Medienbildung von einem komplexen Politikverständnis, das nicht nur die Film- und Medieninhalte, sondern auch ökonomische Rahmenbedingungen, Fragen wie das Urheberrecht oder auch ästhetische Entscheidungen der Filmproduktion in ihrer politischen Dimension begreifen und bewerten lässt. In der Kollaboration beider Disziplinen ist aber noch viel Luft nach oben. In diesem Sinne ist den zukünftigen Kooperationen viel Kreativität und Phantasie zu wünschen.
Autor:
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
1 Hufer, Klaus Peter (2015): Porträt: Oskar Negt.
https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/politische-bildung/193944/portraet-oskar-negt
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020): 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung.
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/162232/16-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
3 Bundeszentrale für politische Bildung (2011): Beutelsbacher Konsens.
https://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens